Der Status quo des Witterungsschutzes im Holzbau: Anforderungen, Umsetzungsdefizite und Forschungsstand
Der moderne Holzbau befindet sich im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach nachhaltigem Bauen und der Notwendigkeit prozesssicherer Ausführung. Mit der zunehmenden Relevanz des urbanen mehrgeschossigen Holzbaus steigt auch die Komplexität in Bezug auf temporären Feuchte- und Witterungsschutz. Während dieser in kleinteiligen Projekten (z. B. Einfamilienhäusern) oft pragmatisch gelöst wird, stoßen größere Vorhaben häufig an systemische Grenzen. Wir schauen auf den Istzustand: rechtliche Grundlagen, Praxisumsetzung, bestehende Herausforderungen und Forschungsansätze.
Gesetzliche Anforderungen und Normenlage
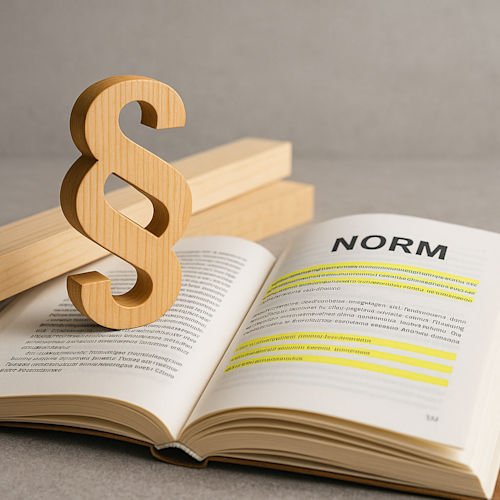
Der bauliche Witterungsschutz im Holzbau fußt auf mehreren normativen Säulen. Zentrale Bedeutung kommt der DIN 68800-2 zu, welche die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes regelt. Sie fordert explizit Schutzmaßnahmen während Lagerung, Transport und Verarbeitung, um eine Feuchteanreicherung über kritische Grenzwerte hinaus zu verhindern. Ebenso wird in der DIN 4108-3 der bauliche Feuchteschutz in Bezug auf Tauwasserbildung und äußere Feuchteeinwirkung geregelt.
Im Kontext der Vertragsgestaltung ist insbesondere die VOB Teil C (DIN 18334 – Zimmer- und Holzbauarbeiten) maßgeblich. Sie fordert u. a. explizit, dass:
„Holzbauteile während Lagerung, Transport und Einbau durch geeignete Maßnahmen gegen Witterungseinflüsse zu schützen sind. Bei Einbau ohne vollständige Witterungssicherheit ist durch geeignete Dokumentation nachzuweisen, dass keine nachteilige Beeinträchtigung erfolgt.“ (DIN 18334, Stand 2019)
In der Praxis bedeutet dies, dass Feuchteschutz leistungsrechtlich geschuldet ist, auch wenn dies in Vergabeunterlagen oft ungenügend formuliert oder gar weggelassen wird.
Umsetzung in der Praxis: Einfamilienhaus versus Objektbau

Während Einfamilienhäuser mit überschaubarer Kubatur und hoher Vorfertigungstiefe in der Regel unter Berücksichtigung günstiger Witterungsfenster montiert werden können, zeigt sich bei größeren Projekten ein deutlich höheres Feuchterisiko. Dies betrifft insbesondere:
Bauzeiten über mehrere Wochen
Großformatige Elemente mit langen Expositionszeiten
Feuchteempfindliche Werkstoffe wie OSB oder Gipsfaserplatten
Fehlende Schutzstrategien in der Ausschreibung
Die Folge sind Wassereinträge während der Bauphase, die im Nachgang nicht immer vollständig rückgeführt werden können. Ein Interview mit Prof. Dr.-Ing. Mike Sieder (TU Braunschweig) im Rahmen des HolzQS-Projekts zeigt: „Die derzeitige Planungspraxis überlässt den Witterungsschutz häufig den ausführenden Firmen – zu spät, zu diffus, zu risikobehaftet.“ (HolzQS-Projektbericht, 2024, FNR)
Forschung und Monitoring: Erste Reaktionen auf Praxisdefizite

Mit dem zunehmenden Bauvolumen in Holzbauweise wächst auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit systemischen Schutzkonzepten. Beispielhaft sind hier zu nennen:
Projekt „HolzQS“ (TU Braunschweig / Brüninghoff / Kehl & Partner, 2023–2026): Entwicklung eines mehrstufigen Qualitätssicherungssystems über alle Projektphasen hinweg. Schwerpunkt: bauzeitliche Feuchteerfassung und entwicklungsbegleitende Sanierungsmethoden.
Projekt „Witterungsschutz“ an der TH Rosenheim (Prof. Dr. Timo Leukefeld): Echtzeitüberwachung von Feuchte in CLT-Decken mittels Sensorik und KI-gestützter Prognosemodelle.
Schweizer Projekt „Lignum Data“ (ETH Zürich): Taktplanung, Risikobewertung und digitale Dokumentation auf mehrgeschossigen Baustellen.
Ein Zwischenergebnis des Projekts HolzQS beschreibt den Bedarf an baubegleitenden Schutzstrategien wie folgt: „Feuchteschutz im mehrgeschossigen Holzbau ist nicht nur eine Frage der Ausführung, sondern der Projektorganisation.“ (Sieder et al., 2024, HolzQS-Zwischenbericht) Ausblick: Notwendigkeit systemischer Verbesserungen Zunehmend mehren sich Stimmen, die eine Pflicht zur Implementierung von Witterungsschutzkonzepten fordern, vergleichbar mit Brandschutzplänen. Das im Entwurf befindliche IDH-Merkblatt „Witterungsschutz 2025“ sieht vor:
Risikoanalyse verpflichtend vor Baubeginn
Mindestanforderungen an Schutzmaßnahmen
Integration in Vergabe- und Werkverträge
Ein Interview mit Dr. Jan Wenker (Brüninghoff Holzbau) bringt es auf den Punkt: „Wir brauchen keine neuen Produkte, sondern eine konsequente Anwendung bestehenden Wissens. Die Normen sind da – sie müssen nur ernst genommen werden.“ (Interview, FNR-Newsletter, Ausgabe 02/2024) Der Witterungsschutz ist im Holzbau längst kein Zusatzthema mehr, sondern ein zentrales Qualitätskriterium. Während die gesetzlichen Grundlagen klar sind, hapert es an der Umsetzung in Planung und Ausschreibung, besonders im Groß- und Objektbau. Forschungsprojekte liefern inzwischen praktikable Ansätze für Monitoring, Planungstools und Qualitätsstandards. Diese müssen jedoch konsequent in die Breite getragen werden, um das Nachhaltigkeitspotential des Holzbaus langfristig zu sichern. Literatur & Quellen:
DIN 68800-2 (2012): Holzschutz – Teil 2
DIN 18334: Zimmer- und Holzbauarbeiten – VOB Teil C (2019)
Sieder, M. et al. (2024): Zwischenbericht Projekt HolzQS, TU Braunschweig
Leukefeld, T. (2023): Vortrag TH Rosenheim, Tagung „Feuchteschutz im CLT-Bau“
Informationsdienst Holz (2021): Merkblatt 04/2021
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR): „Zukunft Bau“-Forschungsberichte